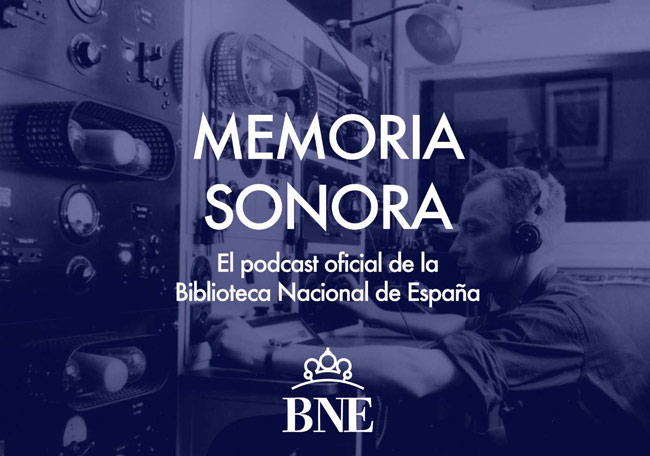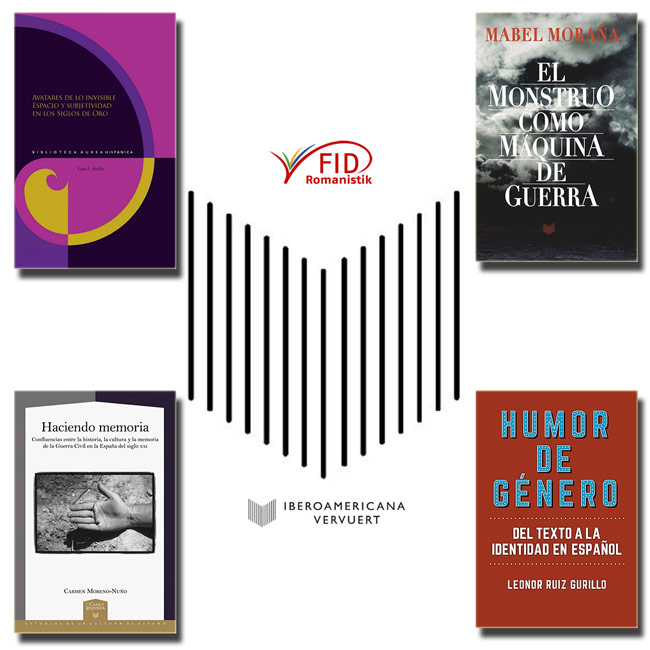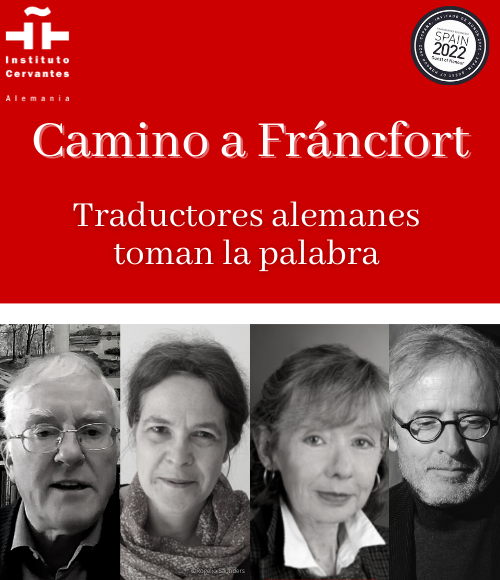Heute stellen wir Ihnen eine weitere Recherchequelle vor, deren Daten wir in den Suchraum des FID Romanistik integriert haben:

Seit 1975 führt das Deutsch-Französische Institut ein Pressearchiv mit systematisch geordneten Presseausschnitten zum Sammelschwerpunkt des Instituts wie beispielsweise die Atomenergiedebatte in Frankreich oder die Entwicklung des deutsch-französischen Fernsehsenders ARTE. Die Sammlung umfasst Titel aus französisch-, deutsch- und englischsprachigen Zeitungen, Magazinen und dem Internet, die nun auch über die Suche des FID Romanistik verfügbar zu finden sind.
„Das Pressearchiv des Deutsch-Französischen Instituts in der FID-Suche“ weiterlesen